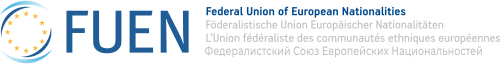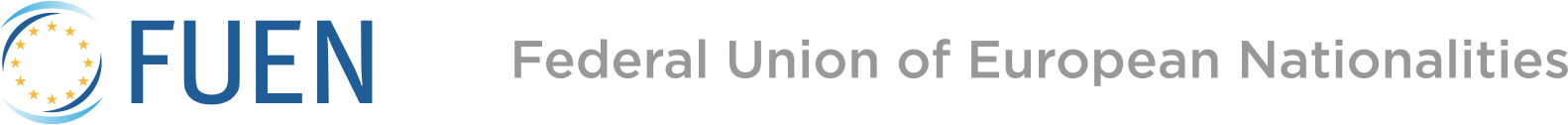.jpg)
FUEN-Arbeitsgemeinschaft Bildung diskutiert Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Minderheitenunterrichts in Europa
20.11.2025Die FUEN-Arbeitsgemeinschaft Bildung hat vom 10. bis 13. November 2025 ihre 7. Jahrestagung abgehalten – diesmal in Komotini (Westthrakien, Griechenland). An dem Treffen nahmen 34 Personen aus elf europäischen Ländern teil, darunter Vertreterinnen und Vertreter nationaler Minderheiten sowie von Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen der Stand der Minderheitenbildung in Europa sowie der Unterricht auf Sekundar- und Oberstufenniveau.

Die FUEN folgte einer Einladung ihrer türkischen Mitgliedsorganisationen aus Westthrakien, die Tagung in Komotini abzuhalten. Damit wurde die Lage des zweisprachigen türkischen Schulsystems in der Region zu einem wesentlichen Teil des Programms – neben der breiteren Betrachtung der Minderheitenbildung und des Unterrichts der Minderheitengeschichte auf Sekundarstufe.

In ihren einleitenden Worten, die FUEN-Präsidentin Olivia Schubert (online zugeschaltet) und Generalsekretärin Eva Pénzes hielten, betonten beide, dass starke Systeme der Minderheitenbildung für kulturelle Kontinuität, Teilhabe und sozialen Zusammenhalt grundlegend sind. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass viele Gemeinschaften unter wachsendem Druck stehen und koordinierte Interessenvertretung daher unerlässlich ist.

In den anschließenden Podiumsdiskussionen berichteten die Teilnehmenden, dass Minderheitenbildung in vielen Regionen von sinkenden Schulzahlen, Lehrkräftemangel, veralteten oder unzureichenden Lehrmaterialien und begrenzter institutioneller Unterstützung geprägt ist. Berichte aus Westthrakien, vorgestellt von Melek Kırmacı, Prof. Dr. Fırat Yaldız, Aydın Ahmet und Ahmet Kara, hoben die starke Reduktion der Zahl der Minderheiten-Grundschulen hervor, die Existenz von nur zwei Minderheiten-Schulen der Sekundar- und Oberstufe, das Fehlen von Kindergärten mit Unterricht auf Türkisch sowie den abnehmenden Einfluss des Minderheitenlehrplans. Die Delegierten stellten fest, dass die verringerte Autonomie der Schulräte und Verwaltungsreformen das System zusätzlich geschwächt haben.

Ähnliche Sorgen äußerten andere Gemeinschaften. Sorbische Vertreterinnen und Vertreter verwiesen auf den gefährdeten Status des Niedersorbischen und den Bedarf an verlässlicher Nachwuchsgewinnung für Lehrkräfte. Vertreterinnen und Vertreter der serbischen Minderheit in Kroatien beschrieben die abnehmende Sichtbarkeit der serbischen Sprache und Kultur an Schulen. Das European Roma Rights Centre berichtete von anhaltender Segregation und ungleichem Zugang zu hochwertiger Bildung in Ungarn.

Diese Herausforderungen prägten auch die curricularen Debatten, in denen der Unterricht der Minderheitengeschichte als zentrales Thema heraustrat. Die Teilnehmenden stellten fest, dass Minderheitengeschichten in nationalen Curricula oft unterrepräsentiert sind und häufig aus Mehrheitsperpektiven gerahmt werden. Lehrkräfte in mehreren Ländern sind auf veraltete Lehrbücher angewiesen oder müssen, insbesondere in zweisprachigen Settings, eigenes Material erstellen. Der Rechtsexperte Thomas Hieber skizzierte die Lücke zwischen formellen Schutzbestimmungen und ihrer praktischen Umsetzung und betonte, dass rechtlich anerkannte Rechte ohne ausreichende Materialien, curricularen Raum und Lehrkräftefortbildung an Wirksamkeit verlieren. Berichte aus Katalonien, von den Burgenlandkroaten, den Ungarndeutschen und den griechischen Gemeinschaften in der Ukraine zeigten, wie politische Entscheidungen, demografischer Wandel und bewaffnete Konflikte die Weitergabe von Minderheitensprache, -kultur und historischem Wissen unmittelbar beeinflussen.

Die Länderberichte zeichneten ein detailliertes Bild dieser Entwicklungen. Vertreterinnen und Vertreter der Plataforma per la Llengua beschrieben, wie das katalanische Immersionsmodell unter politischem und rechtlichem Druck steht und wie jüngste Curriculareformen den Raum für Regionalgeschichte verkleinert haben. Die Delegierten aus Westthrakien schilderten Engpässe bei zweisprachigen Lehrbüchern und eine starke Abhängigkeit von von Lehrkräften erstellten Materialien. Die mazedonische Gemeinschaft in Griechenland berichtete vom völligen Fehlen muttersprachlichen Unterrichts und dem dadurch beschleunigten Sprachwechsel. Vertreterinnen und Vertreter der Burgenlandkroaten und der Ungarndeutschen hoben die Diskrepanz zwischen nationalen Curricula und minderheitenspezifischen Inhalten hervor und erklärten, dass viele Lehrkräfte ergänzende Materialien entwickeln, um ihre Geschichte sichtbar zu halten. Als positives Beispiel stellte Petra Englender-Virth ein Geschichtsschulbuch für den Unterricht zur Geschichte der Ungarndeutschen vor. Die griechischen Gemeinschaften in der Ukraine beschrieben, wie der Krieg den Schulbetrieb stört, die Zahl der griechischsprachigen Schulen von 32 auf 8 gesunken ist und es gravierende Engpässe bei qualifizierten Lehrkräften gibt.

Die schwierige Lage von Minderheiten in Griechenland zeigte sich auch an der Weigerung des Bildungsministeriums, Schulbesuche zu genehmigen. Dies war seit Bestehen der FUEN-Arbeitsgemeinschaft Bildung das erste Mal, dass eine Regierung eine solche Bitte ablehnte. Damit die FUEN dennoch Informationen erhalten konnte, lud die Direktion für Primar- und Sekundarbildung in Rhodope (Rodópi) – der Regionalbezirk, zu dem Komotini gehört und der Teil Westthrakiens ist – zu einem Gespräch ein. Generalsekretärin Eva Pénzes leitete die Delegation, die sich mit der Direktorin Kosmidou Marigoula traf. Sie erläuterte die Verwaltung der Schulen der muslimischen Minderheit, einschließlich der zweisprachigen Struktur, des dualen Lehrplans, der Personalherausforderungen und demografischer Faktoren, die die Tragfähigkeit von Schulen beeinflussen. Zugleich wies sie darauf hin, dass aufgrund der hohen Zahl von Anfragen keine Schulbesuche arrangiert werden konnten.

Während der gesamten Jahrestagung wurde deutlich, dass Dialog auf Augenhöhe entscheidend ist. Eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Schulen, Behörden, Minderheitenorganisationen und Familien ist notwendig, um die Zukunft der Minderheitenbildung zu sichern. Die Teilnehmenden betonten zudem den Bedarf an stärkeren europäischen Rahmenbedingungen zum Schutz von Minderheitensprachen und -identitäten. Die Lage in Westthrakien unterstrich, dass Minderheiten zusammenarbeiten, einander unterstützen und sich austauschen müssen, denn Kooperation stärkt ihre Position innerhalb der Bildungssysteme.


Über alle Sitzungen hinweg betonten die Teilnehmenden, dass eine verlässliche, hochwertige Minderheitenbildung für kulturelle Kontinuität, demokratische Teilhabe und sozialen Zusammenhalt unverzichtbar ist. Einigkeit bestand darin, dass es europaweit einer wirksamen Umsetzung bestehender Rechte, angemessener Ressourcen und belastbarer institutioneller Rahmen bedarf. Die FUEN wird sich weiter für starke, gut ausgestattete Systeme der Minderheitenbildung einsetzen und ihre Arbeit 2026 auf Grundlage der in Komotini geführten Diskussionen weiterentwickeln.


Pressemitteilungen
- Die FUEN wünscht Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten, zuversichtlichen Start ins neue Jahr!
- FUEN fordert die EU zum Handeln gegen systematische ethnisch begründete Landenteignungen in der Slowakei auf
- Women of Minorities-Konferenz in Budapest fordert strukturelle Veränderungen für die gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen aus den Reihen nationaler Minderheiten
- FUEN-Präsidentin Olivia Schubert beim UN-Forum für Minderheitenfragen in Genf
- „Laboratorium des Friedens“: 28. Seminar der slawischen Minderheiten in der Europäischen Kulturhauptstadt Gorica/Gorizia
- Equality in Political Participation and Representation: Drittes „Women of Minorities“-Treffen findet in Budapest statt
- 28. Seminar der slawischen Minderheiten in Europa findet in Gorica/Gorizia (Italien) statt
- Olivia Schubert in ihrem ersten Interview als FUEN-Präsidentin
- FUEN-Delegiertenversammlung wählt neue Führung – Olivia Schubert wird neue Präsidentin
- FUEN-Kongress fährt fort mit der Vorstellung der Minderheiten Südtirols, Sitzungen der Arbeitsgruppen und der Delegiertenversammlung