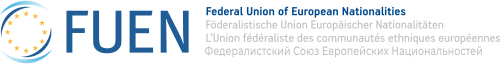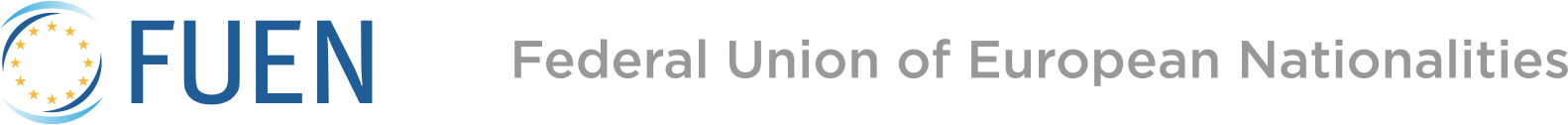.png)
Interview: Elizabete Krivcova über ihre Rolle als Fürsprecherin für Minderheitenrechte in Lettland
22.11.2024Elizabete Krivcova, Anwältin und Menschenrechtsaktivistin, die die russischsprachige Minderheit in Lettland vertritt, engagiert sich seit über 20 Jahren an vorderster Front für die Rechte von Minderheiten. Sie hat wichtige juristische Verfahren auf nationaler und internationaler Ebene geführt und setzt sich für den Schutz von Sprach- und Bildungsrechten in Lettland ein. Trotz wachsender Herausforderungen, darunter strengere Vorschriften für den Gebrauch von Minderheitensprachen und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen, bleibt Krivcova entschlossen, wirksame Lösungen zur Bewahrung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu finden. Sie wird auch auf dem bevorstehenden 8. Forum der Europäischen Minderheitenregionen (26.–27. November 2024 in San Sebastián/Donostia, Baskenland) sprechen. In diesem Interview gibt sie Einblicke in ihre juristischen Fälle und reflektiert über die Herausforderungen, denen die russischsprachige Gemeinschaft in Lettland gegenübersteht.

Elizabete Krivcova
Könnten Sie eine der wichtigsten Initiativen nennen, die Sie in der Vergangenheit geleitet haben, um sich für die Rechte von Minderheiten in Lettland einzusetzen, und welche Lehren Sie daraus gezogen haben?
Von 2012 bis 2014 habe ich ein umfassendes Lobbyprojekt geleitet, den sogenannten Latvian Non-Citizens‘ Congress, das darauf abzielte, die politische Beteiligung von Minderheiten in Lettland zu stärken. Diese Initiative hat sich mit dem Thema Staatsangehörigkeit in Lettland befasst, da aus historischen Gründen etwa 25 Prozent der nationalen Minderheiten keine lettische Staatsangehörigkeit besitzen. Unser Ziel war es, diese Gruppe in das politische Leben zu integrieren und ihnen das Wahlrecht bei Kommunalwahlen zu sichern. Wir führten eine breite Kampagne durch und erhielten starke öffentliche und internationale Unterstützung. Leider konnten wir die Regierungsparteien nicht überzeugen, einen integrativeren Ansatz zu verfolgen.
Wenn ich über diese und andere Bemühungen nachdenke, eine bürgerliche statt einer rein ethnischen Nation aufzubauen, bin ich überzeugt, dass eine starke Idee, selbst wenn sie durch internationales Recht gestützt wird, allein nicht ausreicht. Veränderungen erfordern wirtschaftlichen Einfluss und eine gestärkte Rechtsstaatlichkeit.
Könnten Sie uns, wenn Sie an Ihre langjährige Arbeit als Anwältin für Sprachrechte zurückdenken, von Ihren Erfahrungen aus früheren Fällen vor nationalen und internationalen Gerichten sowie den Trends berichten, die Sie im Laufe der Jahre beobachtet haben?
Zwischen 2004 und 2024 war ich als Teammitglied oder Vertreterin an Fällen beteiligt, die Minderheitensprachen betrafen und vor dem lettischen Verfassungsgericht, dem EGMR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) oder dem EuGH (Europäischer Gerichtshof) verhandelt wurden. Diese Verfahren umfassten Themen wie den Gebrauch von Minderheitensprachen in Kindergärten, Schulen und Universitäten. Derzeit bearbeite ich einen Fall vor dem lettischen Verfassungsgericht, der das Verbot von Minderheitensprachen in Wahlkampagnen anfechtet.
Auf Grundlage dieser Erfahrungen lässt sich sagen, dass der Schutz von Minderheitenrechten oft unzureichend ist. Zwar prüfen Gerichte diese Fälle, ihre Entscheidungen garantieren jedoch meist nur ein Minimum an Rechten. So haben wir beispielsweise erlebt, wie das Recht auf Unterricht in Minderheitensprachen von 40 Prozent im Jahr 2005 auf ein vollständiges Verbot reduziert wurde, bei dem nicht einmal die Minderheitensprache selbst Teil des Lehrplans sein darf.
Obwohl es in den letzten Jahren einige hoffnungsvolle Urteile des EGMR gab, beobachten wir nun einen Trend hin zu eingeschränkten sprachlichen Rechten für Minderheiten. Staaten erhalten dabei einen größeren Ermessensspielraum, diese Rechte zugunsten der Mehrheitsbevölkerung einzuschränken.
Selbst wenn Rechtsfälle erfolglos sind, haben sie dann trotzdem noch positive Auswirkungen auf die Rechte von Minderheiten?
Ja, auch erfolglose Rechtsfälle können praktische positive Auswirkungen haben. Erstens müssen staatliche Institutionen ihre Entscheidungen vor Gericht rechtfertigen, wobei das Gericht Standards für künftige Entscheidungen setzt. Zweitens zwingt dies die Behörden, sich mit praktischen Problemen auseinanderzusetzen. Oft werden Probleme vor einer Gerichtsverhandlung gelöst, um Kritik zu vermeiden, beispielsweise durch angemessene Finanzierungszusagen. Selbst wenn wir das größere Problem nicht lösen können, lassen sich oft kleinere Probleme angehen.
Der einzige Fall im Bereich der Bildungssprache, den wir gewonnen haben, basierte übrigens auf der allgemeinen akademischen Freiheit, nicht auf Minderheitenrechten. Allgemeine Rechte erweisen sich häufig als wirksamer als spezifische Minderheitenrechte. Was die Sprache im Bildungswesen betrifft, bin ich überzeugt, dass wir die Bildungsfreiheit stärken müssen, damit Minderheiten von diesem allgemeinen Recht profitieren können. Untersuchungen zeigen, dass die Bildungsfreiheit weltweit abnimmt.
Wie haben die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und globalen Trends die Wahrnehmung und den Schutz von Minderheitenrechten beeinflusst, insbesondere in Lettland?
Meine Arbeit fand und findet unter schwierigen Umständen statt. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine herrscht ein weit verbreitetes Misstrauen gegenüber russischsprachigen Menschen, und es wird versucht, die russischsprachige Minderheit in Lettland mit der Politik Russlands zu assoziieren. Dabei lebt diese Gemeinschaft seit über 300 Jahren in Lettland und hat oft engere Beziehungen zu Lettland als zu Russland.
Schwierige Zeiten stellen die Belastbarkeit von Grundsätzen auf die Probe. Unser Fall zeigt, wie fragil Mechanismen zum Schutz von Minderheitenrechten sein können. Weltweit beobachten wir ähnliche Tendenzen. Minderheitenrechte sind oft nur wirksam, wenn der Kin-State sie unterstützt, was dem Grundgedanken der Minderheitenrechte als Menschenrechte widerspricht. Ohne zusätzliche Anstrengungen wird der Rückgang der Minderheitenrechte wohl anhalten.
Lettland hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das Russisch auf allen öffentlichen Webseiten verbietet. Welche unmittelbaren und langfristigen Folgen hat dies Ihrer Meinung nach?
Dieses Gesetz schränkt für weniger gebildete und schutzbedürftige Teile der Minderheitenbevölkerung den Zugang zu Informationen über staatliche und kommunale Dienstleistungen erheblich ein, was soziale Ungleichheit verstärkt. Studien zeigen zudem, dass das Fehlen von Informationen in Minderheitensprachen die Entfremdung vom Staat fördert und interethnische Spannungen verschärft. Dies könnte restriktivere und autoritärere Maßnahmen nach sich ziehen, was sowohl wirtschaftlich ineffizient ist als auch die soziale Stabilität gefährdet.
Was sind die dringendsten Herausforderungen, mit denen ethnische Minderheiten in Lettland heute konfrontiert sind, und wie können diese bewältigt werden?
Eine zentrale Herausforderung ist, Kindern aus Minderheiten eine qualitativ hochwertige Bildung zu bieten. Das Schulsystem ist nicht darauf vorbereitet, die große Zahl von Kindern zu unterstützen, die andere Sprachen sprechen. Da Privatschulen ebenfalls keinen Unterricht in Minderheitensprachen anbieten dürfen, verlagert sich dieser zunehmend in informelle Bereiche, was die Bildungssituation weiter erschwert.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, unsere Identität in einer Zeit neu zu definieren, in der der Staat, mit dem wir früher kulturell zusammengearbeitet haben, Krieg führt. Viele russischsprachige Gruppen in Europa suchen ihren Platz in diesem neuen Kontext. Neue Wege der Zusammenarbeit sind entscheidend, doch die Instabilität der persönlichen Umstände erschwert dies.
Welche Strategien oder Best Practices würden Sie Minderheitengemeinschaften empfehlen, die sich in komplexen legislativen Umgebungen für ihre Rechte einsetzen?
Ich empfehle, sich auf die Stärkung allgemeiner Menschenrechte wie Bildungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Nich-Diskriminierung zu konzentrieren. Zudem können digitale Technologien helfen, restriktive staatliche Vorschriften zu umgehen und kulturelle sowie sprachliche Praktiken aufrechtzuerhalten.
Weiterführende Informationen:
- Mehr über die Arbeit und das Engagement von Elizabete Krivcova für Minderheitenrechte erfahren Sie auf ihrer Website: https://krivcova.lv/en
Pressemitteilungen
- Die FUEN wünscht Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten, zuversichtlichen Start ins neue Jahr!
- FUEN fordert die EU zum Handeln gegen systematische ethnisch begründete Landenteignungen in der Slowakei auf
- Women of Minorities-Konferenz in Budapest fordert strukturelle Veränderungen für die gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen aus den Reihen nationaler Minderheiten
- FUEN-Präsidentin Olivia Schubert beim UN-Forum für Minderheitenfragen in Genf
- „Laboratorium des Friedens“: 28. Seminar der slawischen Minderheiten in der Europäischen Kulturhauptstadt Gorica/Gorizia
- Equality in Political Participation and Representation: Drittes „Women of Minorities“-Treffen findet in Budapest statt
- FUEN-Arbeitsgemeinschaft Bildung diskutiert Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Minderheitenunterrichts in Europa
- 28. Seminar der slawischen Minderheiten in Europa findet in Gorica/Gorizia (Italien) statt
- Olivia Schubert in ihrem ersten Interview als FUEN-Präsidentin
- FUEN-Delegiertenversammlung wählt neue Führung – Olivia Schubert wird neue Präsidentin